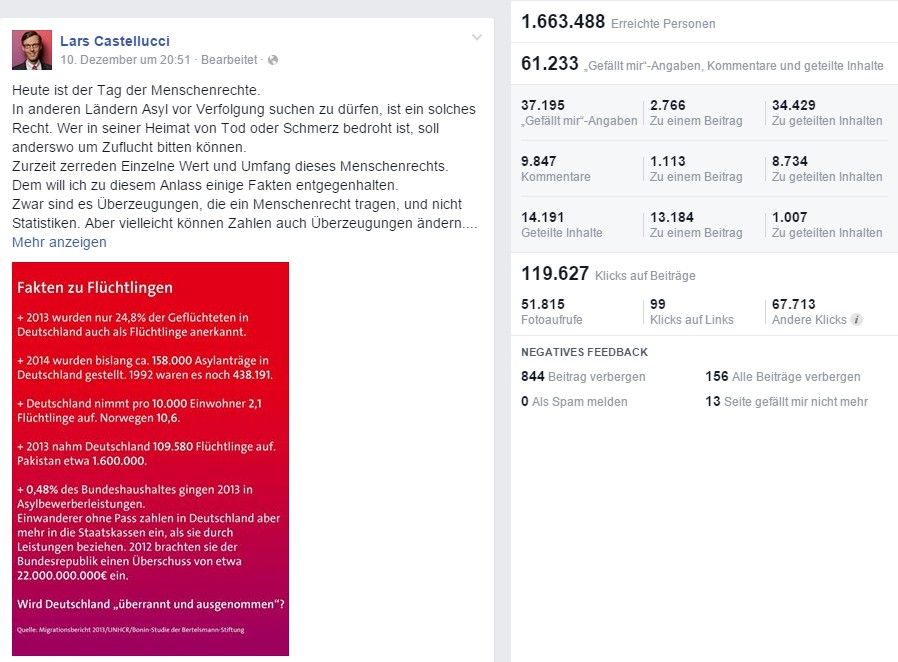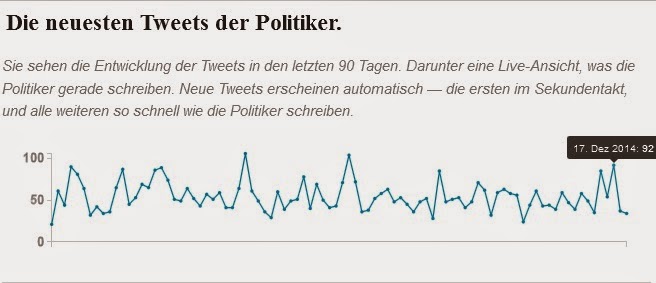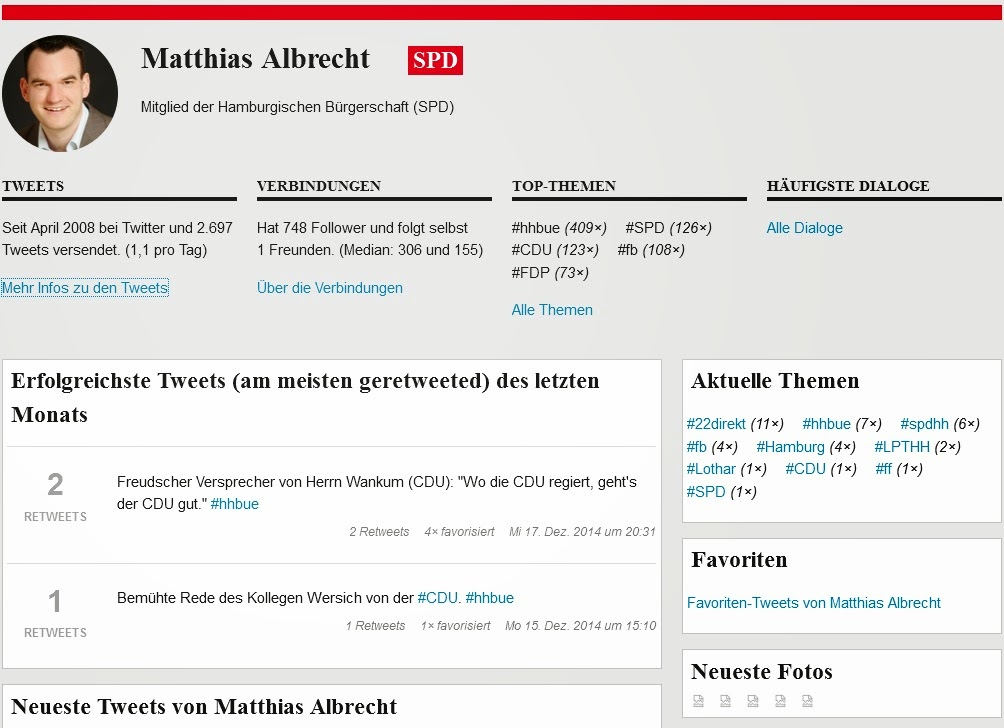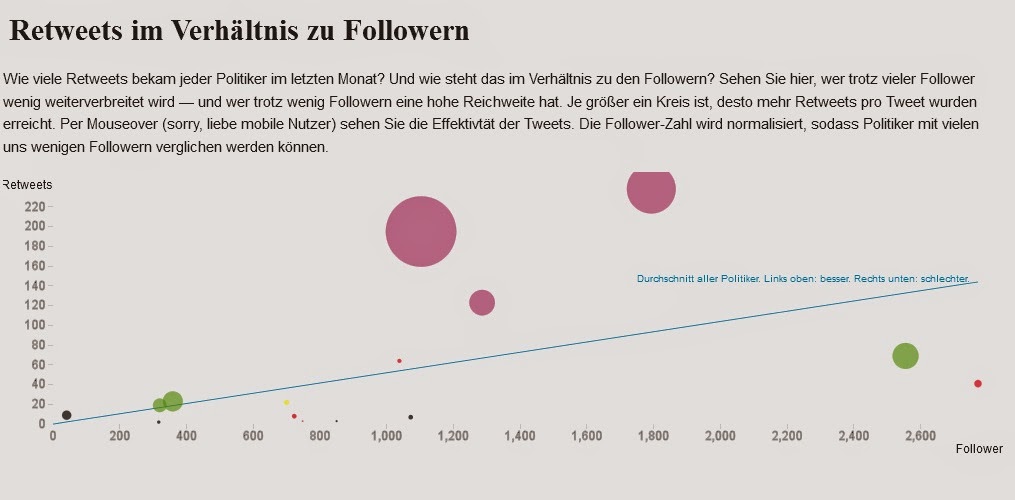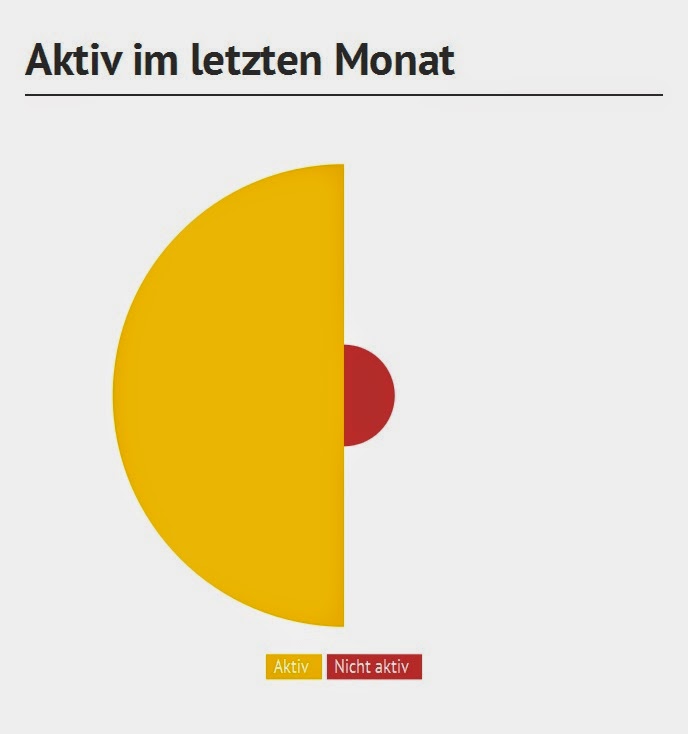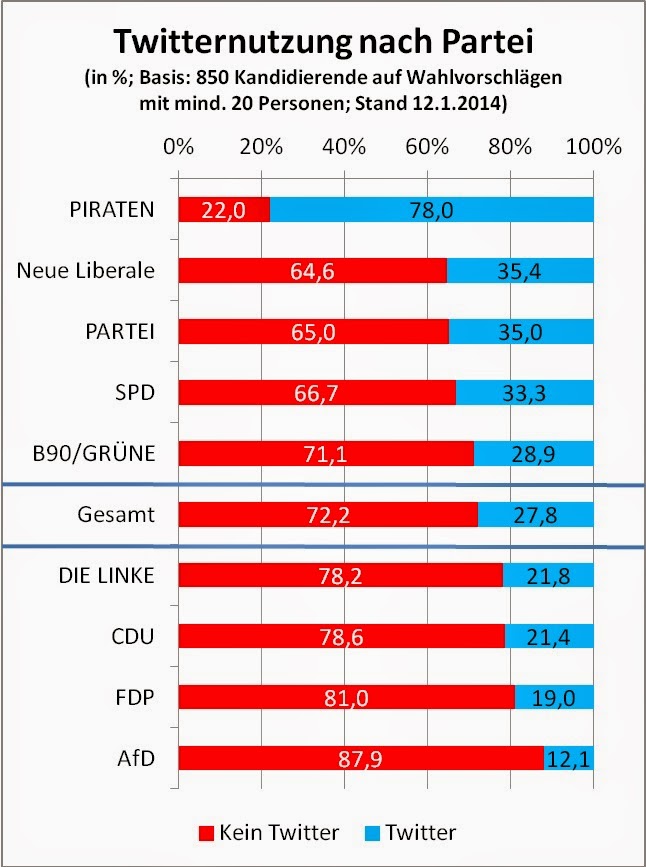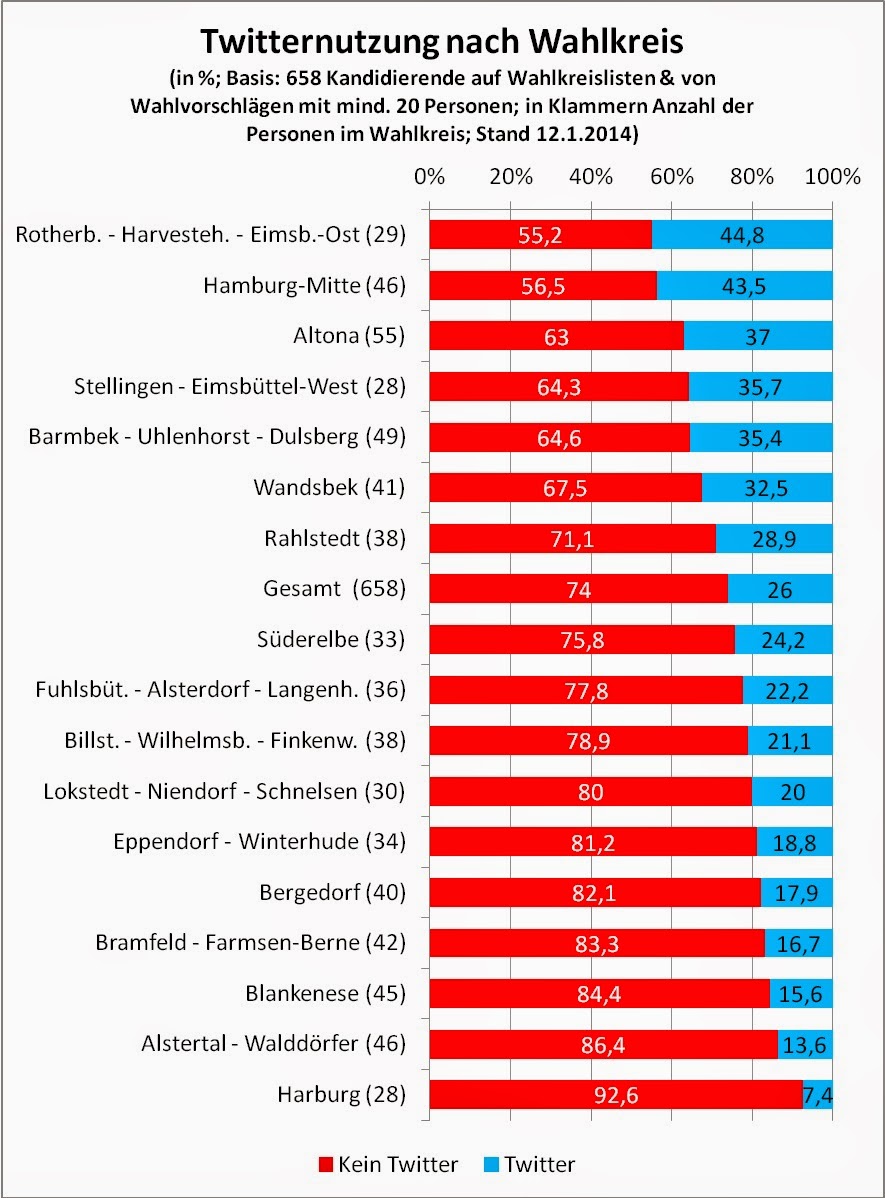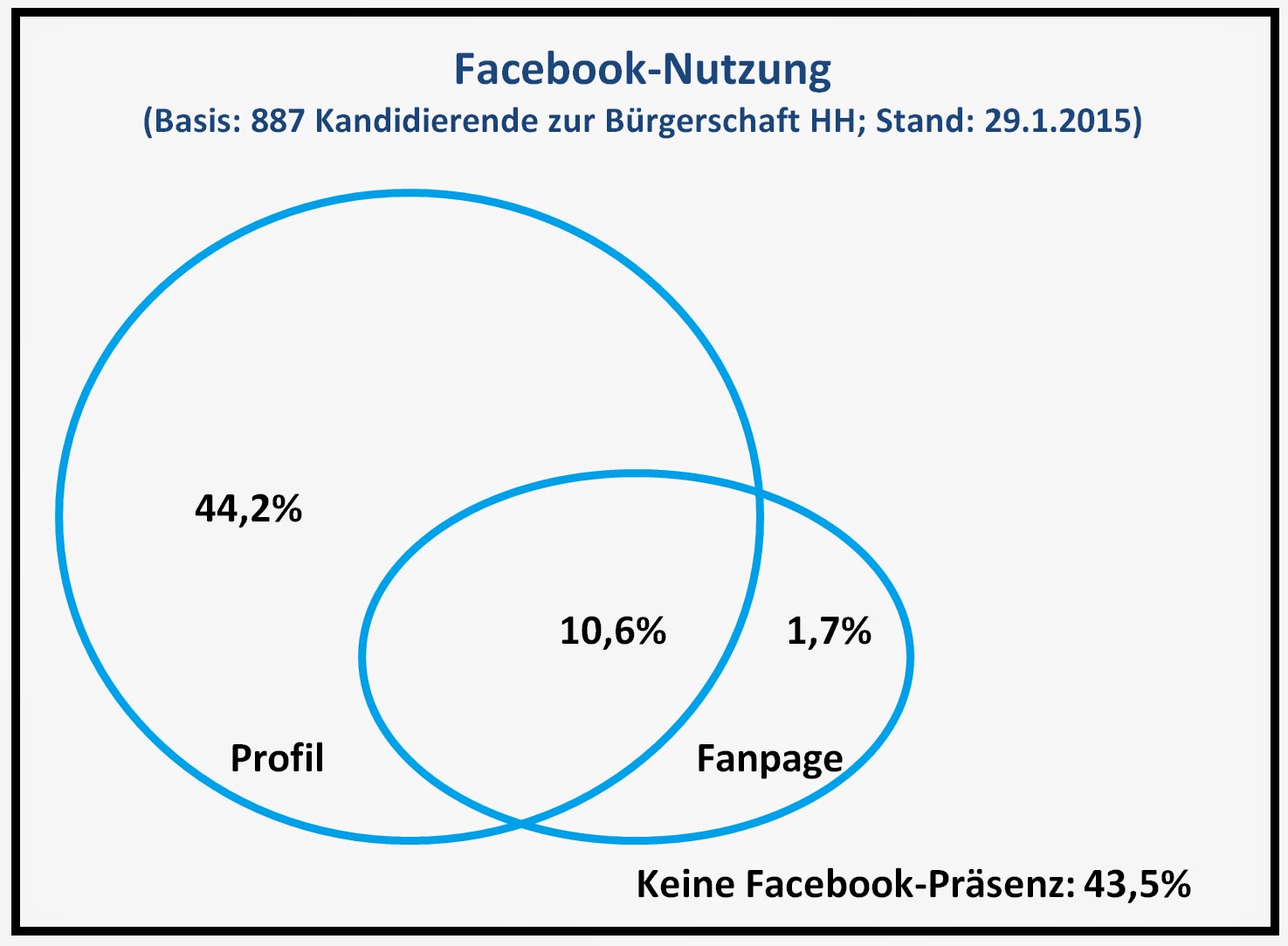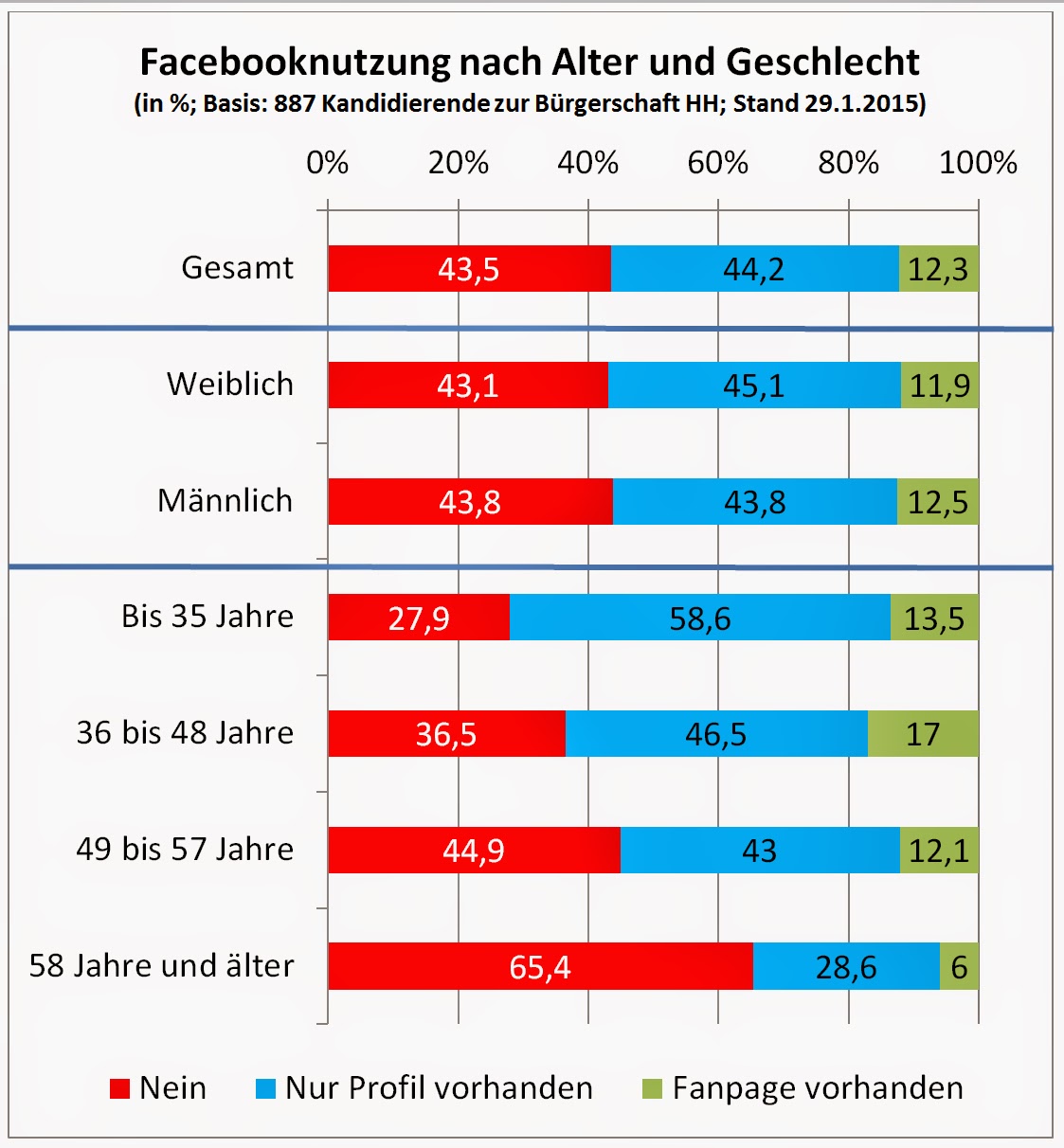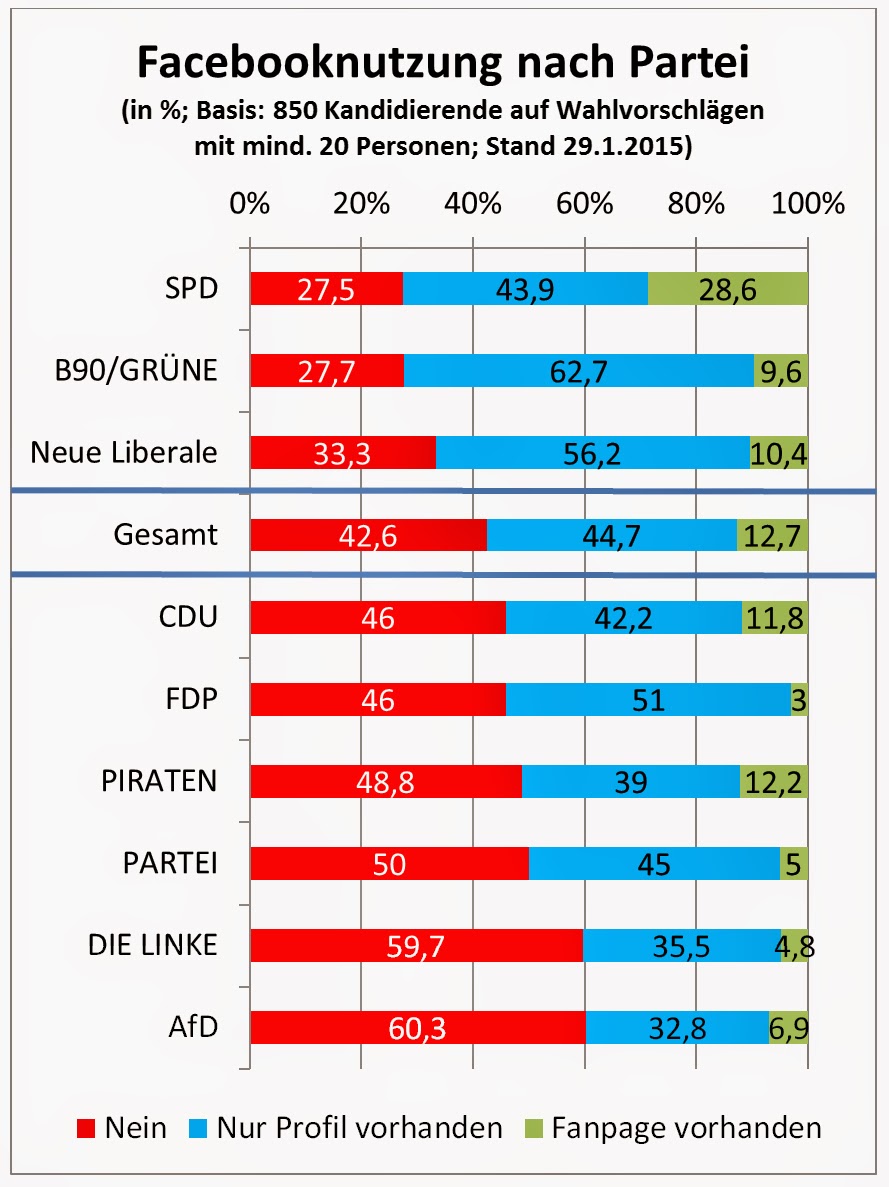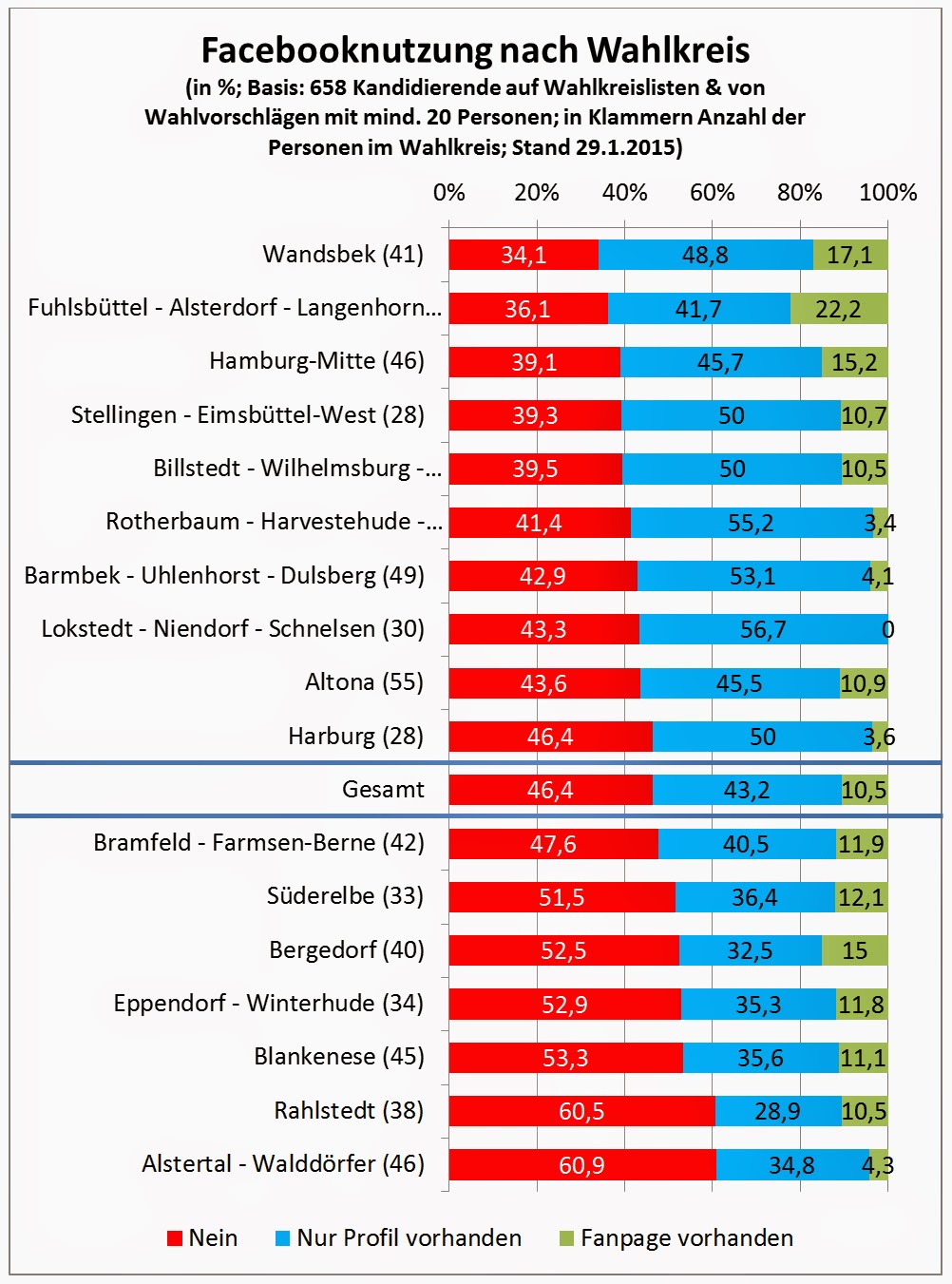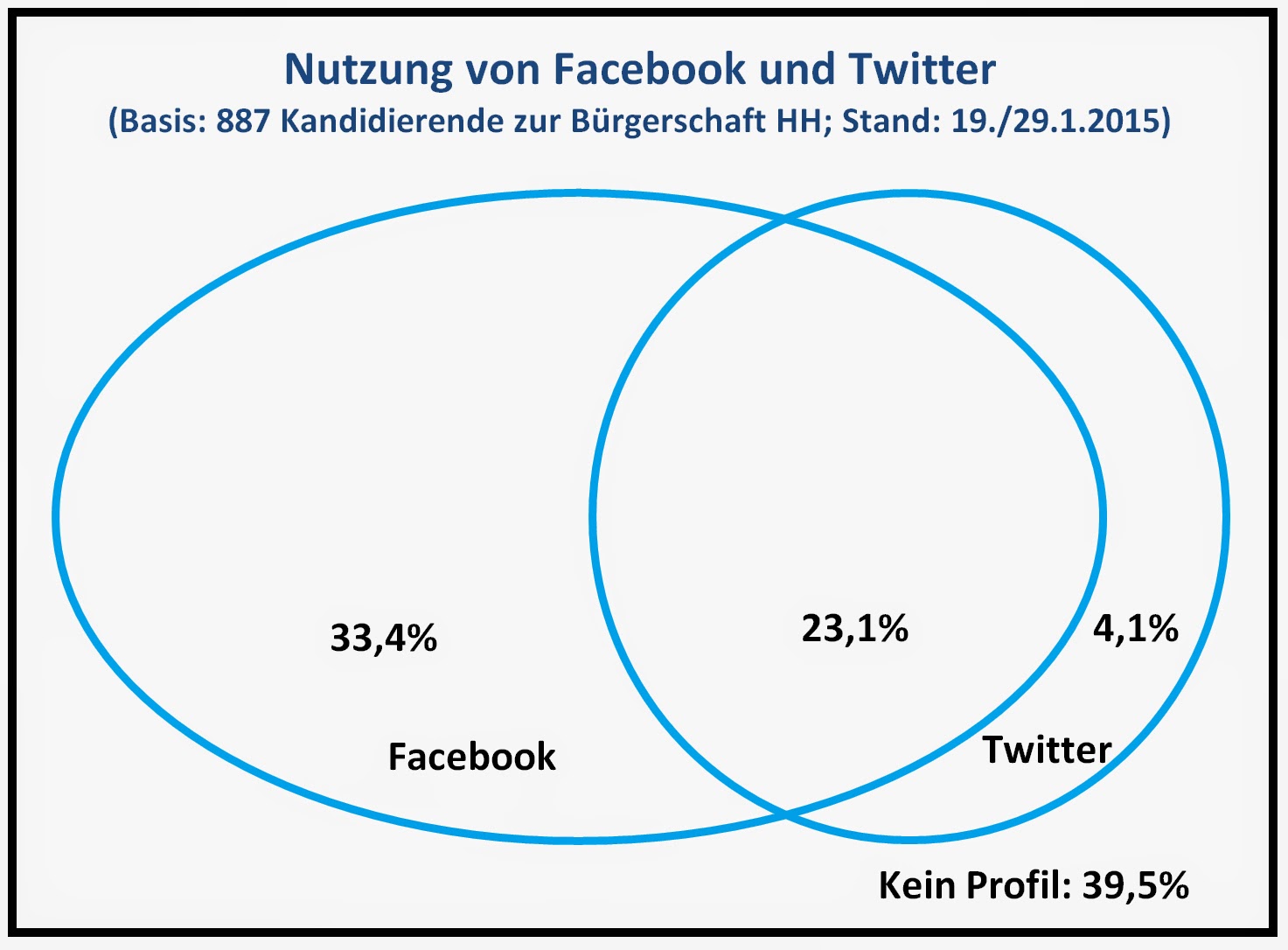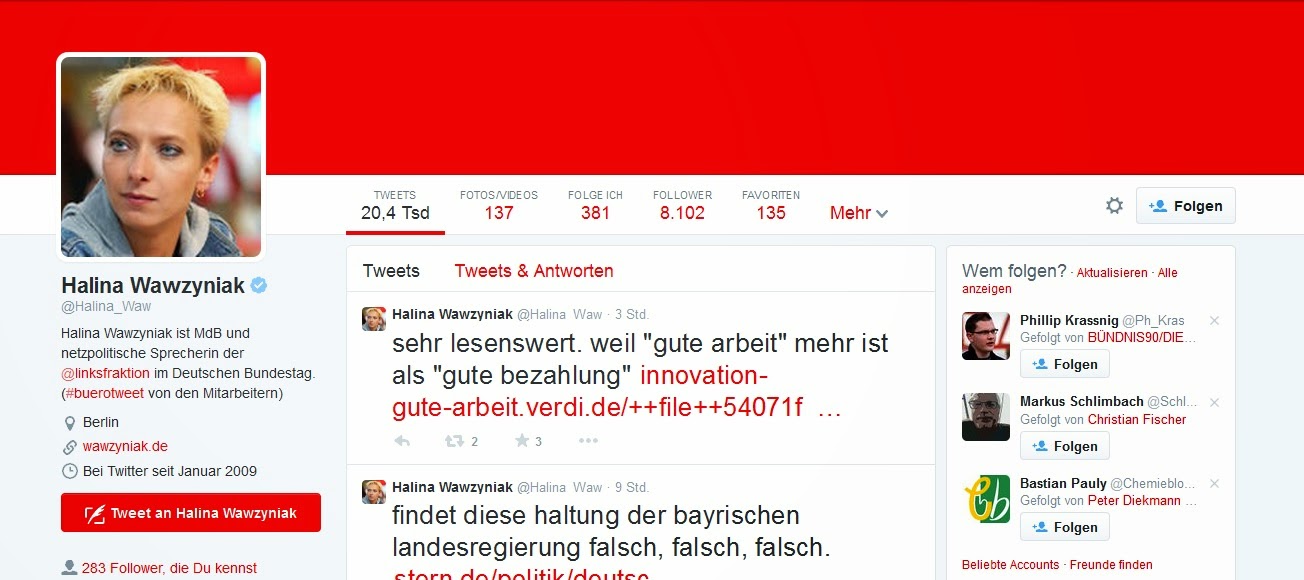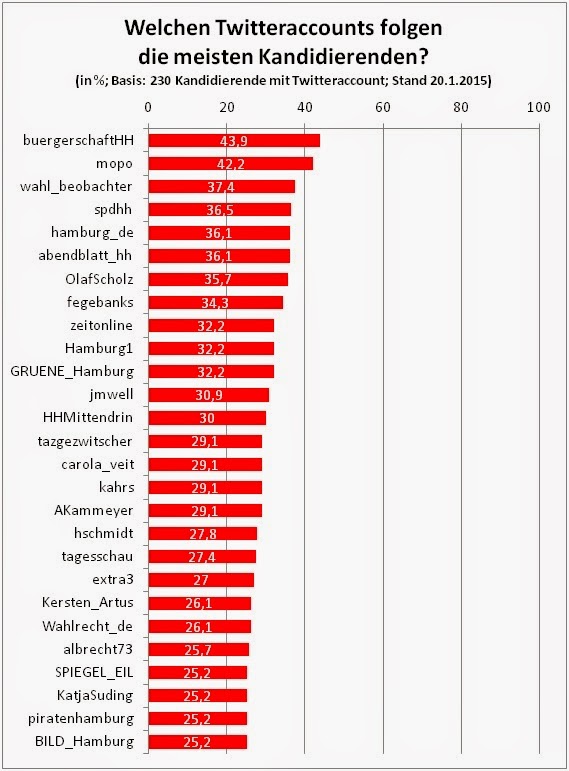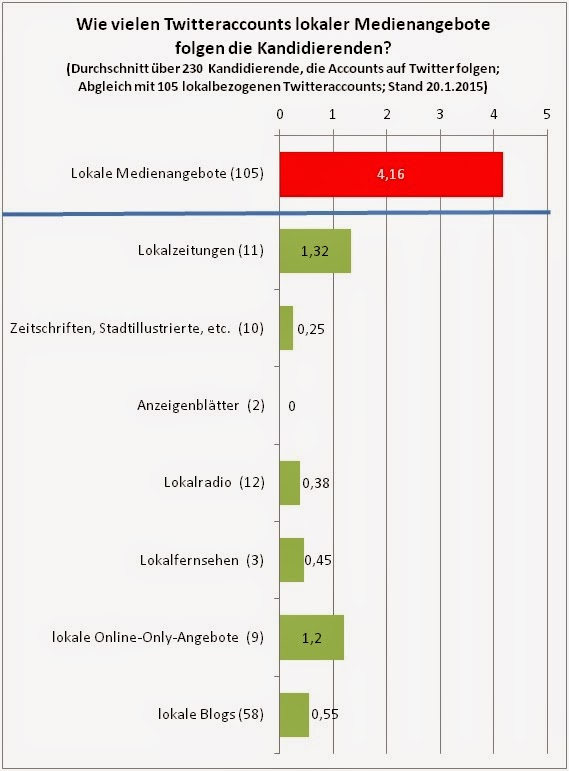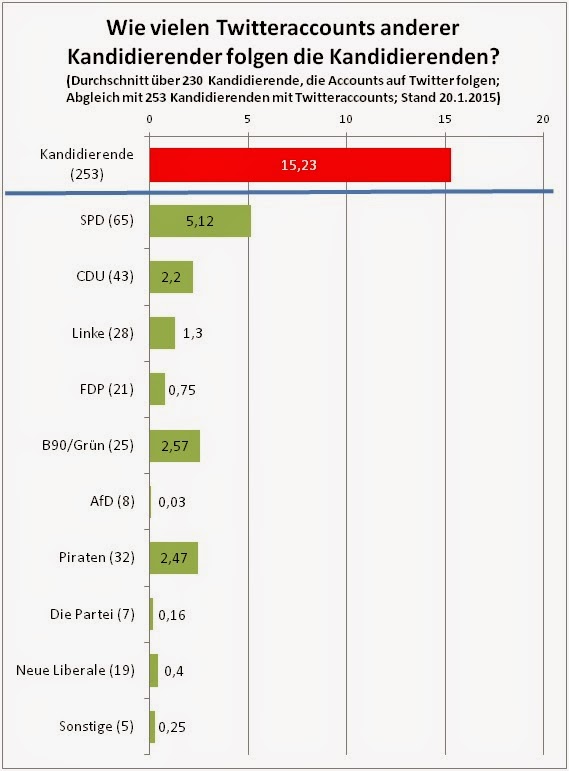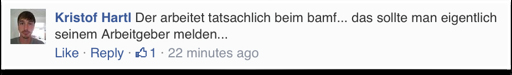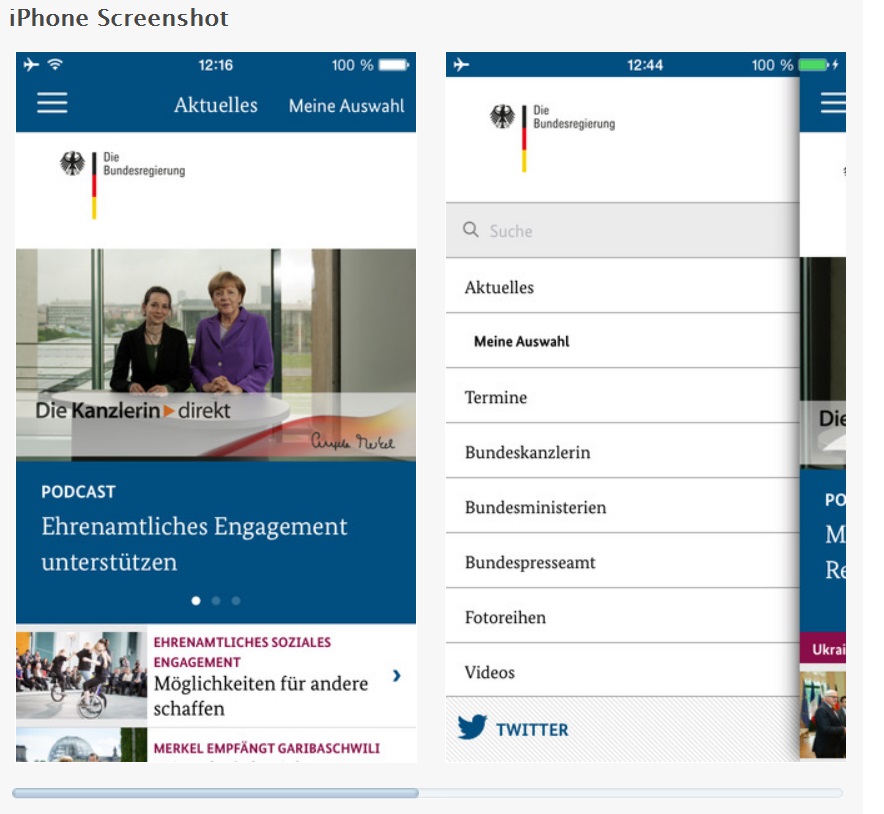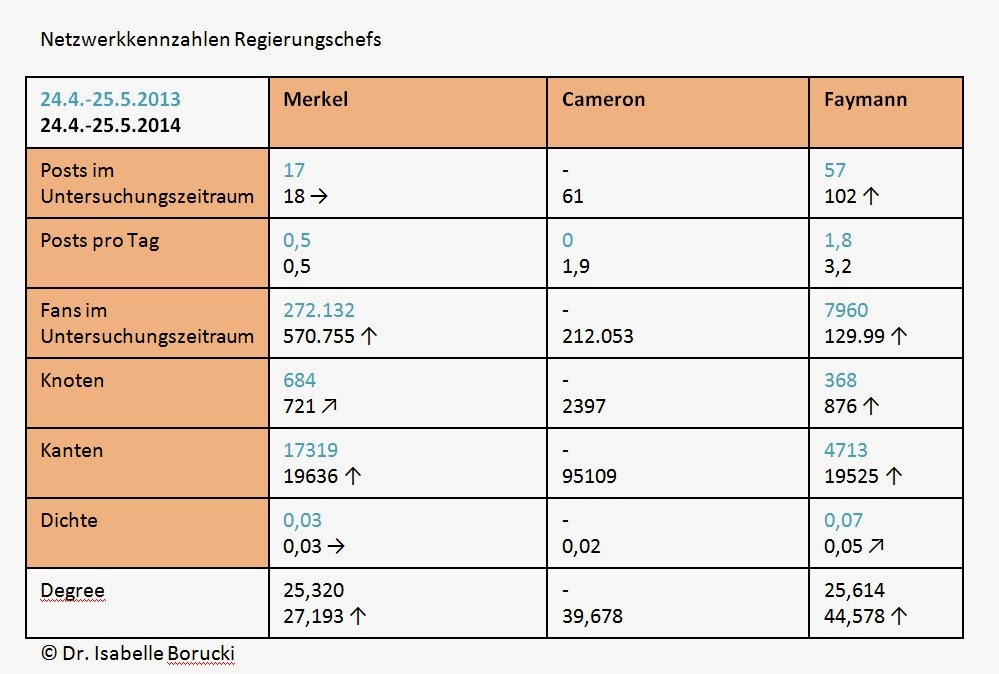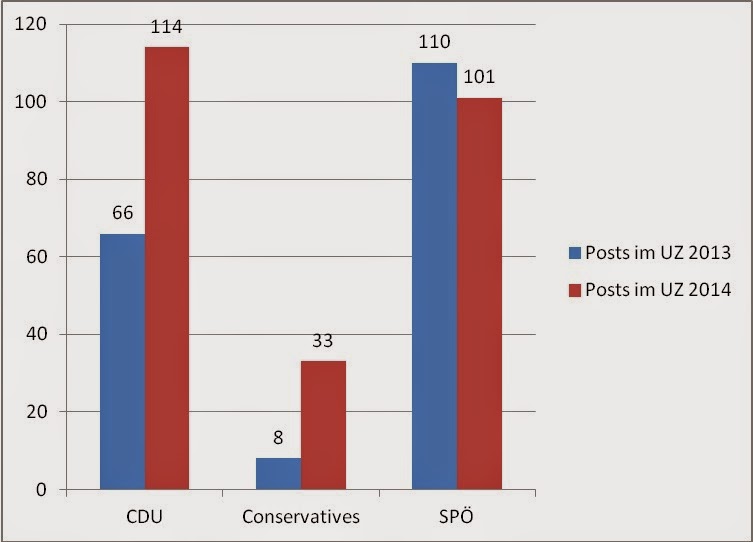Dies ist ein Gastbeitrag von Katharina Esau vom Institut für Sozialwissenschaften der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Bei der Studie handelt es sich um ihre Masterarbeit im Fach Politische Kommunikation, die im Rahmen der studentischen Forschergruppe „Kampagnenmanagement– Parteien im Bundestagswahlkampf 2013“ unter Leitung von Dr. Sebastian Bukow entstanden ist.
 |
| Logo Heinrich Heine Universität Düsseldorf |
Sie konnten erstmals auf Basis der Daten der Deutschen Kandidatenstudie von 2005 zeigen, dass Kandidaten neben parteizentrierten, weiterhin sogenannte individualisierte Wahlkampfstrategien verfolgen, und dabei gezielt versuchen die Aufmerksamkeit auf die eigene Kandidatur und Person zu lenken. Darüber hinaus belegen ihre Analysen, dass durch wahlsystemische Faktoren – wie z.B. eine Gewinnchance im Wahlkreis – Anreize für solche individualisierten Wahlkämpfe ausgehen. Inwiefern sich die in Befragungen sichtbar werdenden Tendenzen in Richtung individualisierter Wahlkampf tatsächlich in den Kampagnen der Kandidaten manifestieren, wurde in der vorliegenenden Studie zum ersten Mal untersucht. Dabei wurde u. a. die Annahme, dass Kandidaten mit guten Gewinnchancen im Wahlkreis stärker individualisierte Wahlkampfstrategien aufweisen, als Kandidaten mit schlechten bzw. keinen Gewinnchancen, anhand der Online-Wahlkämpfe der Kandidaten überprüft.
Pilotstudie: Untersuchung individualisierter Strategien anhand der Gestaltung und Inhalte von Kandidaten-Websites
 |
| Wahlkreisergebnisse Direktmandat in NRW Bundestagswahl 2013 |
“Clearly, online media provide new opportunities for candidates to personalize their campaigns. Focusing on these new media contexts thus allows testing for the robustness of established theories on the electoral sources of campaign behavior” (Zittel 2014: 3).
In der vorliegenden Untersuchung wurden die Individualisierungsthese und die Erklärungskraft wahlsystemischer Faktoren [1], erstmalig anhand der Gestaltung und der Inhalte der Kampagnen-Websites von Wahlkreiskandidaten mit Hilfe einer Inhaltsanalyse getestet. Dafür wurde ein Instrument zur systematischen Analyse der Websites entwickelt.
Operationalisierung und Kriterien zur Untersuchung der Websites
 |
| Carsten Linnemann (CDU) erhielt 2013 die meisten Erstimmen in NRW (59,1%) |
Insgesamt wurden mit Rückgriff auf bestehende inhaltsanalytische Untersuchungen von Kampagnen-Websites (Gibson/Ward 2000; Gulati/Williams 2007; Hermans/Vergeer 2013) je 18 Indikatoren bzw. Kategorien für die individualisierte und für die parteizentrierte Strategie speziell für die Untersuchung von Kandidaten-Websites erarbeitet. Es wurde darauf geachtet, dass die Kategorien sowohl den Inhalt, als auch die Form der Websites ansprechen. Mit Blick auf die bisherigen Studien wurden die einzelnen Kategorien mit den Oberbegriffen Werbung, Information, Positionierung, Vernetzung, Mittelbeschaffung und Mobilisierung zusammengefasst.
![]() Beispielsweise sollte untersucht werden, ob sich die auf der Website präsentierten Wahlkampfthemen von den Kernthemen der Partei unterscheiden. Denn es liegt die Annahme vor, dass Kandidaten mit einer individualisierten Strategie auf parteiunabhängige Themen setzen. Für die Partei liegt im Hinblick auf die Themen der nationalen Kampagne eine klare Wahlkampfstrategie vor, die im Parteiprogramm und auch auf der Website der Partei festgehalten wird. Kandidaten haben die Möglichkeit in ihren lokalen Kampagnen spezielle Problembereiche, die z. B. im Wahlkreis zu verorten, hervorzuheben. Die analytische Herausforderung bestand darin, parteiabhängige und parteiunabhängige Themen voneinander abzugrenzen, da Kandidaten die Themen der Partei häufig einfach in den lokalen Kontext ihrer Wahlkreise ‚übersetzen‘ (vgl. Karlsen/Skogerbø 2013). Daher wurde die Präsentation der Wahlkampfthemen sowohl im Hinblick auf die sprachliche Darstellung, als auch auf die Inhalte [3]selbst, untersucht. Mithilfe der Daten konnten pro Partei die fünf wichtigsten Positionen bzw. Themen im Bundestagswahlkampf 2013 bestimmt werden.
Beispielsweise sollte untersucht werden, ob sich die auf der Website präsentierten Wahlkampfthemen von den Kernthemen der Partei unterscheiden. Denn es liegt die Annahme vor, dass Kandidaten mit einer individualisierten Strategie auf parteiunabhängige Themen setzen. Für die Partei liegt im Hinblick auf die Themen der nationalen Kampagne eine klare Wahlkampfstrategie vor, die im Parteiprogramm und auch auf der Website der Partei festgehalten wird. Kandidaten haben die Möglichkeit in ihren lokalen Kampagnen spezielle Problembereiche, die z. B. im Wahlkreis zu verorten, hervorzuheben. Die analytische Herausforderung bestand darin, parteiabhängige und parteiunabhängige Themen voneinander abzugrenzen, da Kandidaten die Themen der Partei häufig einfach in den lokalen Kontext ihrer Wahlkreise ‚übersetzen‘ (vgl. Karlsen/Skogerbø 2013). Daher wurde die Präsentation der Wahlkampfthemen sowohl im Hinblick auf die sprachliche Darstellung, als auch auf die Inhalte [3]selbst, untersucht. Mithilfe der Daten konnten pro Partei die fünf wichtigsten Positionen bzw. Themen im Bundestagswahlkampf 2013 bestimmt werden.
Es wurden alle Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien (mit FDP) in NRW berücksichtigt. Die Inhaltsanalyse umfasst alle Kandidaten mit Web-Auftritt im Rahmen der Bundestagswahl 2013 (N=231).Damit besaßen 72,4 Prozent der insgesamt 319 in NRW angetretenen Kandidaten eine eigene Kampagnen-Website.
 Beispielsweise sollte untersucht werden, ob sich die auf der Website präsentierten Wahlkampfthemen von den Kernthemen der Partei unterscheiden. Denn es liegt die Annahme vor, dass Kandidaten mit einer individualisierten Strategie auf parteiunabhängige Themen setzen. Für die Partei liegt im Hinblick auf die Themen der nationalen Kampagne eine klare Wahlkampfstrategie vor, die im Parteiprogramm und auch auf der Website der Partei festgehalten wird. Kandidaten haben die Möglichkeit in ihren lokalen Kampagnen spezielle Problembereiche, die z. B. im Wahlkreis zu verorten, hervorzuheben. Die analytische Herausforderung bestand darin, parteiabhängige und parteiunabhängige Themen voneinander abzugrenzen, da Kandidaten die Themen der Partei häufig einfach in den lokalen Kontext ihrer Wahlkreise ‚übersetzen‘ (vgl. Karlsen/Skogerbø 2013). Daher wurde die Präsentation der Wahlkampfthemen sowohl im Hinblick auf die sprachliche Darstellung, als auch auf die Inhalte [3]selbst, untersucht. Mithilfe der Daten konnten pro Partei die fünf wichtigsten Positionen bzw. Themen im Bundestagswahlkampf 2013 bestimmt werden.
Beispielsweise sollte untersucht werden, ob sich die auf der Website präsentierten Wahlkampfthemen von den Kernthemen der Partei unterscheiden. Denn es liegt die Annahme vor, dass Kandidaten mit einer individualisierten Strategie auf parteiunabhängige Themen setzen. Für die Partei liegt im Hinblick auf die Themen der nationalen Kampagne eine klare Wahlkampfstrategie vor, die im Parteiprogramm und auch auf der Website der Partei festgehalten wird. Kandidaten haben die Möglichkeit in ihren lokalen Kampagnen spezielle Problembereiche, die z. B. im Wahlkreis zu verorten, hervorzuheben. Die analytische Herausforderung bestand darin, parteiabhängige und parteiunabhängige Themen voneinander abzugrenzen, da Kandidaten die Themen der Partei häufig einfach in den lokalen Kontext ihrer Wahlkreise ‚übersetzen‘ (vgl. Karlsen/Skogerbø 2013). Daher wurde die Präsentation der Wahlkampfthemen sowohl im Hinblick auf die sprachliche Darstellung, als auch auf die Inhalte [3]selbst, untersucht. Mithilfe der Daten konnten pro Partei die fünf wichtigsten Positionen bzw. Themen im Bundestagswahlkampf 2013 bestimmt werden. Es wurden alle Kandidaten der im Bundestag vertretenen Parteien (mit FDP) in NRW berücksichtigt. Die Inhaltsanalyse umfasst alle Kandidaten mit Web-Auftritt im Rahmen der Bundestagswahl 2013 (N=231).Damit besaßen 72,4 Prozent der insgesamt 319 in NRW angetretenen Kandidaten eine eigene Kampagnen-Website.
Gewinnchance erklärt Unterschiede zwischen den Web-Auftritten
Es sind zwar Standards erkennbar, die sich z. B. im Aufbau der Websites zeigen und u. a. mit der Gegnerbeobachtung und den Angeboten der Parteien (Baukastensysteme für Kampagnen-Websites) erklärt werden können. Trotzdem lassen sich deutliche Unterschiede im Hinblick auf die Gestalt und Inhalte der Websites erkennen. Einige Kandidaten stellen ihre Partei und deren Kernthemen im Wahlkampf in den Vordergrund, andere legen den Fokus auf die eigene Person und entwickeln eigene Themen, Positionen und Ziele. Es existieren Web-Auftritte bei denen ganz auf ein Logo der Partei verzichtet wird, sodass kaum noch ersichtlich ist, welcher Partei der Kandidat angehört. Die Unterschiede deuten auf verschiedene strategische Ausrichtungen hin.
 |
Abbildung 1: Beispiel für Website ohne Parteilogo: Marco Bülow (SPD), MdB |
Um diese Unterschiede zu erklären, wurden die forschungsleitenden Hypothesen anhand von multivariaten Analysen getestet. Da es für die Wahlkampfstrategien auf Kandidaten-Websites bisher nur erste theoretische Ansätze gibt, wurden drei Dimensionen individualisierter und parteizentrierter Strategien identifiziert: Werbung, Information und Positionierung. Auf Basis der je drei Indizes wurden Differenzwerte als abhängige Variablen gebildet. Im nächsten Schritt konnte der positive und hoch signifikante Zusammenhang zwischen einer guten Gewinnchance im Wahlkreis und dem Wahlkampfstil auf der Website im Hinblick auf die Dimensionen Werbung (β = .33; p < .001), Information (β = .27; p < .001) und Positionierung (β = .44; p < .001) nachgewiesen werden. Anhand der Gewinnchance können 10 Prozent der Varianz der individualisierten Werbung, 7 Prozent der individualisierten Information und 19 Prozent der individualisierten Positionierung aufgeklärt werden. Somit bestätigte sich der theoretisch vermutete Effekt bei der Analyse der Web-Auftritte. Der Grad der Individualisierung auf der persönlichen Kampagnen-Website erweist sich bei denjenigen Kandidaten als stärker, die auch eine realistische Chance besitzen das Direktmandat im Wahlkreis zu gewinnen.
 |
Abbildung 2: individualisierte vs. parteizentrierte Wahlkampfstrategien, N=231 |
Diskussion und Ausblick
Das Ziel der Untersuchung war es, Indikatoren für die Analyse individualisierter vs. partei-zentrierter Wahlkampfstrategien zu entwickeln und weiterhin die Erklärungskraft wahlsystemischer Anreize zu testen. Die multivariaten Analysen deuten darauf hin, dass die unterschiedlichen Wahlkampfstile von wahlsystemischen Anreizen beeinflusst werden. Neben der Gewinnchance wurden weiterhin die Mandatsinhaberschaft und ein sicherer bzw. unsicherer Listenplatz als unabhängige Variablen getestet. Der relativ stärkste Effekt geht von einer guten Gewinnchance im Wahlkreis auf individualisierte Wahlkampfstrategien aus.
Betrachtet man die drei Dimensionen näher, wird deutlich, dass die Kampagnen der Kandidaten am stärksten im Hinblick auf die Positionierung, bestehend aus den Kategorien Ziele, Themen und Positionen des Kandidaten bzw. der Partei, variieren. Eine mögliche Begründung dafür ist, dass es hinsichtlich der Verwendung von werbenden Elementen wie Fotos, Logos und Slogans sowie hinsichtlich der Bereitstellung von Informationen bereits gewisse Standards gibt, an denen sich die Kandidaten ausrichten. Es ist heute selbstverständlich, ein Foto des Kandidaten an bestimmten Stellen auf der Website zu platzieren oder in gewissem Ausmaß Informationen zur Person des Kandidaten bereitzustellen. Größere Unterschiede herrschen hinsichtlich der politischen Positionierung der Kandidaten bzw. der Parteien. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass die Entwicklung und Formulierung eigener Ziele, Themen und Positionen zeitaufwendig und daher für Kandidaten mit Kosten verbunden ist. Weiterhin gibt es hier weniger Standards und daher mehr Spielraum.
Die Untersuchung weist darauf hin, dass individualisierte Strategien mehr sind als nur ein Teil der Personalisierung von Wahlkampf. Individualisierung tritt im Hinblick auf Websites insbesondere bei der Analyse der Ziele, Themen und Positionen der Kandidaten zu Tage. Daher lohnt es sich weiterhin neben dem äußeren Erscheinungsbild, auch die Inhalte der Kampagnen von Wahlkreiskandidaten zu untersuchen.
Literatur
Gibson, Rachel/Ward, Stephen (2000): A Proposed Methodology for Studying the Function and Effectiveness of Party and Candidate Web Sites. In: Social Science Computer Review, 18 (3), S. 301-319.
Gulati, Girish J./Williams, Christine B. (2007): Closing the Gap, Raising the Bar: Candidate Web Site Communication in the 2006 Campaigns for Congress. In: Social Science Computer Review, 25 (4), S. 443-465.
Hermans, Liesbeth/Vergeer, Maurice (2013): Personalization in e-campaigning: A cross-national comparison of personalization strategies used on candidate websites of 17 countries in EP elections 2009. In: New Media & Society, 15 (1), S. 72-92.
Karlsen, Rune/Skogerbø, Eli (2013): Candidate campaigning in parliamentary systems: Individualized vs. localized campaigning. In: Party Politics, S. 1-12.
Norris, Pippa (2000): A virtuous circle. political communications in postindustrial soci-eties. New York: Cambridge University Press.
Schmitt, Hermann/Wüst, Andreas (2004): Direktkandidaten bei der Bundestagswahl 2002: Politische Agenda und Links-Rechts-Selbsteinstufung im Vergleich zu den Wählern. In: Brettschneider, Frank/van Deth, Jan/Roller, Edeltraud (Hrsg): Bundestagswahl 2002. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 167-183.
Turner, Julius (1953): Primary Elections as the Alternative to Party Competition in ‘Safe’ Districts. In: The Journal of Politics, 15, S. 197-210.
Volkens, Andrea/Lehmann, Pola/Merz, Nicolas/Regel, Sven/Werner, Annika (2013): The Manifesto Data Collection. Manifesto Project (MRG/CMP/MARPOR). Version 2013a. Berlin: Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
Zittel, Thomas/Gschwend, Thomas (2007): Individualisierte Wahlkämpfe im Wahlkreis – eine Analyse am Beispiel des Bundestagswahlkampfes von 2005. In: Politische Vierteljahresschrift: Zeitschrift der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, 48 (2), S. 293-321.
Zittel, Thomas/Gschwend, Thomas (2008): Individualised constituency campaigns in mixed-member electoral systems: Candidates in the 2005 German elections. In: West European Politics, 31 (5), S. 978-1003.
Zittel, Thomas (2014): Do Candidates Seek Personal Votes on the Internet? Constituency Candidates in the 2013 German Federal Elections (August 9, 2014). online über SSRN: http://ssrn.com/abstract=2478180
Autorin
Katharina Esau ist Doktorandin am NRW Fortschrittskolleg Online-Partizipation. Sie studierte politische Kommunikation an der Heinrich Heine Universität Düsseldorf.
[1]In diesem Beitrag liegt der Fokus auf der Gewinnchance, wobei in der Untersuchung weitere Faktoren untersucht wurden.
[2]Social Network Service
[3] Für die inhaltliche Untersuchung wurden die Ergebnisse des Manifesto-Projekts verwendet. Das Projekt basiert auf quantitativen Inhaltsanalysen der Wahlprogramme politischer Parteien in mehr als 50 Ländern für alle freien demokratischen Wahlen seit 1945.















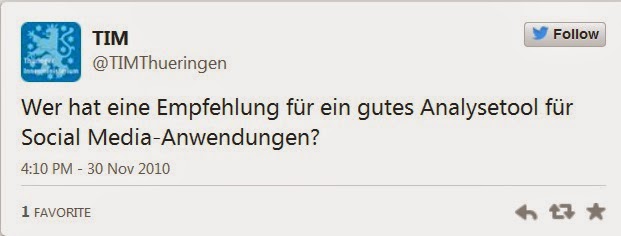













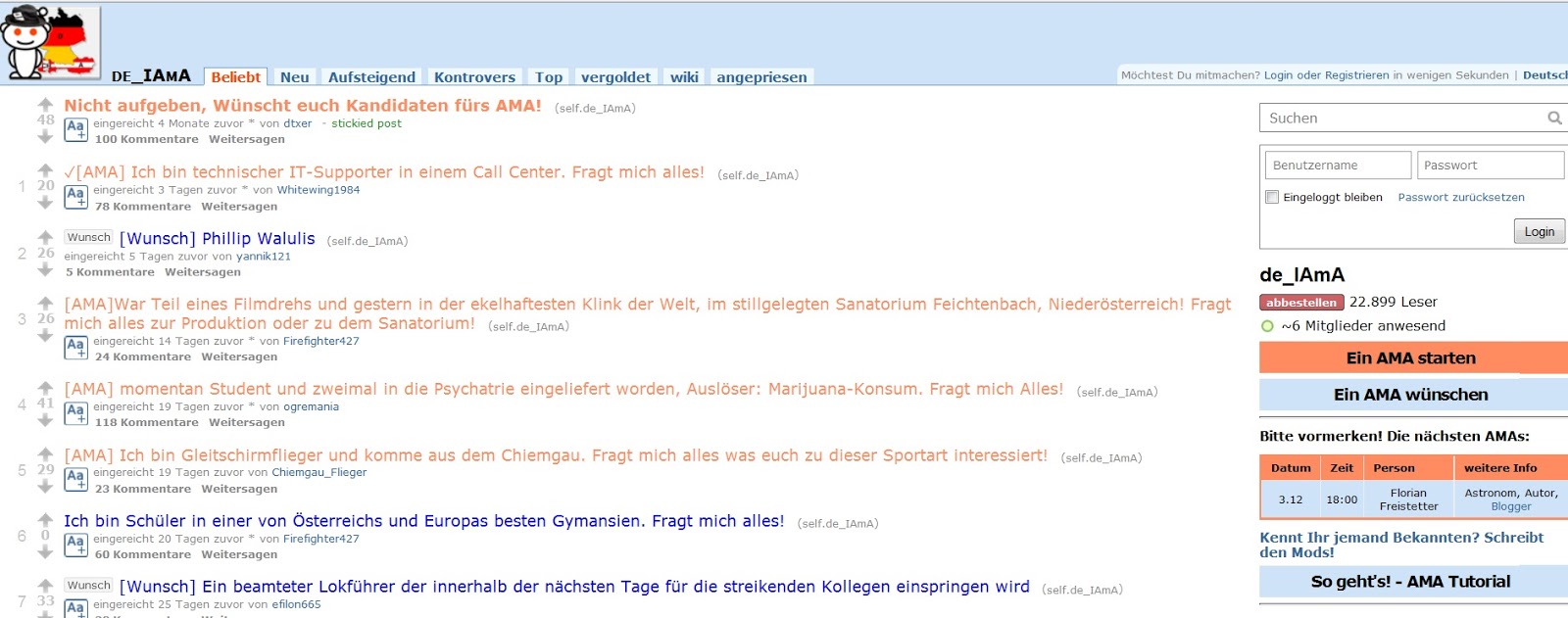
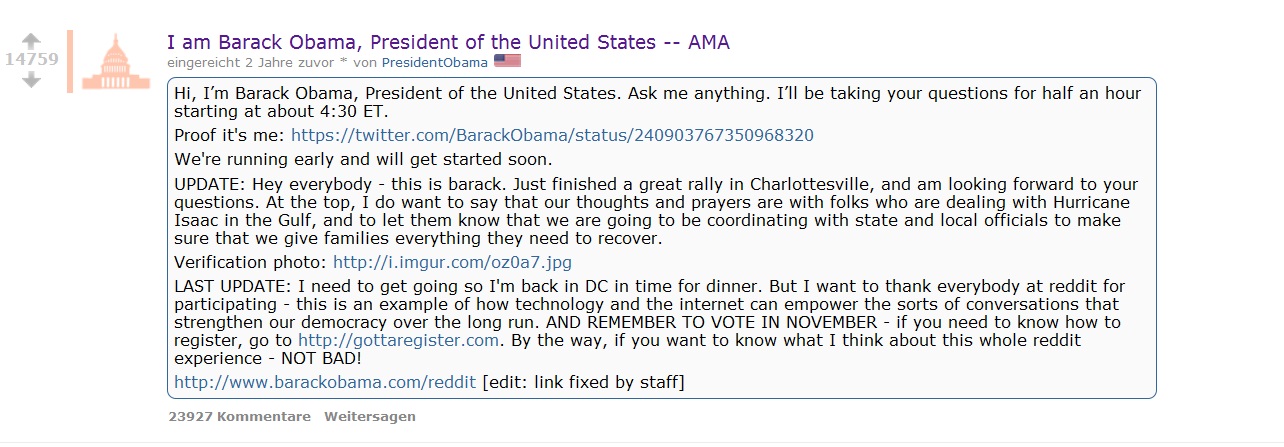





.jpg)